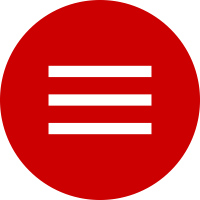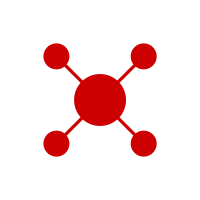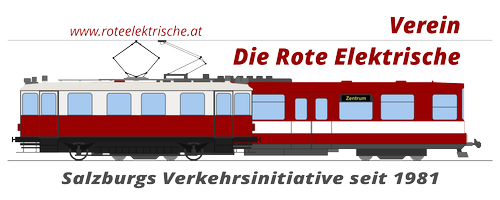Als am 10.8.1886 der erste Dampftramway-Zug vom Salzburger Hauptbahnhof in die Stadt fuhr, begann das, was man heute „Nahverkehr“ bezeichnet. Zwischen Platzl „Innerer Stein“ und dem „Äußeren Stein“ wurde, entlang der Salzach, ein eigener Bahndamm für die „Salzburger Localbahn“ gebaut, der wenig später auch für Fuhrwerke genutzt werden konnte, und heute „Imbergstraße“ heißt. Diese Dampftramway wurde in Etappen über Nonntal, Kleingmain, Morzg, Hellbrunn, Anif und Grödig bis zum „Gasthof Drachenloch“ in St. Leonhard, unterhalb des Untersberges, gebaut und in Betrieb genommen.
Mit der Eröffnung der Gaisberg-Zahnradbahn 1887 gab es ein starkes Verkehrsbedürfnis zwischen der Stadt und der Talstation in Parsch. So wurde ein Streckenast der Dampftramway vom Äußeren Stein nach Parsch, zur Tauernbahn und zur Zahnradbahn gebaut. Während der Eröffnung der Tauernbahn 1909 größte Beachtung geschenkt wurde, fiel die Einführung der Elektromobilität mit der „Roten Elektrischen“ nur wenigen Menschen auf. Zu Zeiten, als elektrischer Strom bei Straßenbeleuchtung und gar in Haushalten noch nicht vorstellbar waren, erregten die neuen elektrischen Triebwagen im Straßenraum der Stadt letztendlich derart viel Aufsehen, dass der Volksmund die Bahn bald „Rote Elektrische“ taufte.
Die Salzburger Eisenbahn- und Tramway-Gesellschaft SETG, wie die Salzburger Lokalbahn damals offiziell hieß, hat zusammen mit den Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen (K.Bay.Sts.B.) etwas schier Unglaubliches geschafft, was bis heute nicht mehr wieder möglich wurde. Sie realisierten eine grenzüberschreitende Bahn zwischen Salzburg und Bayern bis zum Königssee, mit einheitlichen Fahrzeugen (Rote Elektrische, Grüne Elektrische), einheitlichem Tarif und einheitlichem durchgehenden Betrieb von Salzburg, Grödig, Schellenberg und Berchtesgaden bis zum Königssee.
Die Nordlinie, die „Oberndorferbahn“, ab 1896
Zehn Jahre nach der Südlinie der Lokalbahn ging 1896 die „Oberndorferbahn“, die Nordlinie, als Dampfeisenbahn zwischen Salzburg, Bergheim, Anthering, Oberndorf und Bürmoos nach Lamprechtshausen in Betrieb. Erst kurz vor der Zerstörung der Lokalbahn-Südlinien 1953 wurde die Nordlinie elektrifiziert. Erst damals kam die SAKOG-Kohlenschleppbahn Bürmoos-Trimmelkam dazu, die lange Jahre von Stern & Hafferl Gmunden betrieben und 1993, auf Betreiben der „Aktionsgemeinschaft Rote Elektrische“ an die Salzburger Lokalbahn übergeben wurde.
1981 Rettung der Salzburger Lokalbahn durch engagierte Bürger
Die „Aktionsgemeinschaft rettet die Rote Elektrische“ hat 1981 in einer spontanen Unterschriftenaktion knapp 15.000 Unterschriften in einer Region mit etwas mehr als 30.000 Einwohnern gesammelt. Damit wurde die Zerstörung der Bahn verhindert. Aus der „Aktionsgemeinschaft rettet die Rote Elektrische“ wurde 1984 „Aktionsgemeinschaft Rote Elektrische“, später „Verein S-Bahn Salzburg“, heute „Die Rote Elektrische“.
Die Neuzeit als moderne Regional-Stadtbahn
Sofort nach Bekanntgabe der Rettung der Lokalbahn kamen die ersten Stadtbahn-Gelenktriebwagen der Reihe 40. Das war dann, für die Bevölkerung, das erste sichtbare Zeichen der Modernisierung der Salzburger Lokalbahn. Die völlige Modernisierung der Strecke mit dem Neubau aller Brücken erlebte die Bevölkerung mit Streckenunterbrechungen und Schienenersatzverkehren mit Bussen. Gedankt wurde das von der Bevölkerung mit steigenden Fahrgastzahlen.
Markantestes Ereignis und von der gesamten Bevölkerung vielbeachtet verfolgt, war von 1992 bis 1996 der Bau des unterirdischen Lokalbahnhofes, der am 19. September 1996 zum Jubiläum „110 Jahre Salzburger Lokalbahnen“, in Betrieb ging. Es war der erste entscheidende Schritt zum Weiterbau für die unterirdische Verlängerung als Regionalstadtbahn. Obwohl bereits bei der Eröffnung des unterirdischen Lokalbahnhofes der Weiterbau des Tunnels unter der Salzburger Innenstadt im Raum stand, eigentlich „vor der Tür stand", wartet die Bahn seit damals noch immer auf die Realisierung der Lokalbahn-Verlängerung als Teil des Regionalstadtbahn-Netzes im Zentralraum Salzburg.